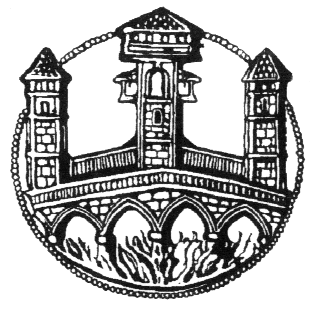|
Prof. Dr. Ernst Christoph Suttner, Wien
Dass zwischen Katholiken und Orthodoxen derzeit ein Schisma besteht, bestreitet niemand. Ebenfalls unbestritten ist, dass es bereits in grauer Vorzeit zwischen den Vorfahren der gegenwärtigen Katholiken und Orthodoxen Schismen von unterschiedlicher Gewichtigkeit gab. Sie bestanden schon, als die Bezeichnungen "Katholiken" bzw. "Orthodoxe" noch nicht gebräuchlich waren, sondern die Parteien gemäß ihrer Gottesdienst- und Theologiesprache noch "Lateiner" bzw. "Griechen" genannt wurden.
Das gegenwärtige Schisma zwischen Katholiken und Orthodoxen
- Die katholische und die orthodoxe Kirche gelten heutzutage bei vielen als im Glauben voneinander getrennt. Sogar manche Theologen, die sich durch die ökumenischen Bemühungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beeindrucken lassen und beide Seiten "Kirche" nennen, stimmen in dieses Urteil ein. In Hinblick auf das nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, das nur eine einzige heilige, katholische und apostolische Kirche kennt, müssten jedoch alle katholischen und orthodoxen Theologen, welche die Existenz einer solchermaßen radikalen Scheidewand zwischen ihren beiden Gemeinschaften behaupten, die eigene Kirche mit Entschiedenheit für die alleinseligmachende Kirche Jesu Christi halten; die "andere Seite" müssten sie, damit ihre Position kohärent sein kann, eine in die Irre geleitete Glaubensgemeinschaft nennen.
Das wichtigste Lehrdokument, das die entsprechende Überzeugung auf katholischer Seite einst hochoffiziell vorgetragen hatte, ist die Enzyklika "Mystici Corporis" von Pius XII., datiert vom 22.6.1943; dort heißt es: "Den Gliedern der Kirche sind nur jene in Wahrheit zuzuzählen, die das Bad der Wiedergeburt empfingen, sich zum wahren Glauben bekennen und sich weder selbst zu ihrem Unsegen vom Zusammenhang des Leibes getrennt haben noch wegen schwerer Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche Obrigkeit davon ausgeschlossen worden sind … (hingegen können) die, welche im Glauben oder in der Leitung voneinander getrennt sind, nicht in diesem einen Leib und aus seinem einen göttlichen Geiste leben."(1) Ein entsprechendes Lehrdokument von orthodoxer Seite ist der Beschluss der griechischen Patriarchen vom Juli 1755, in dem es heißt: "… wir verwerfen in gemeinsamem Beschluss die Sakramente der Häretiker als verkehrt, als der apostolischen Überlieferung fremd und als Erfindungen verdorbener Menschen … und wir nehmen die Konvertiten, die zu uns kommen, als Ungeheiligte und Ungetaufte auf …."(2) Dem gegenüber führte die orthodox-katholische Dialogkommission 1993 in ihrer Erklärung von Balamand aus, "dass das, was Christus seiner Kirche anvertraut hat - Bekenntnis des apostolischen Glaubens, Teilhabe an denselben Sakramenten, vor allem am einzigen Priestertum, welches das einzige Opfer Christi feiert, Apostel-Nachfolge der Bischöfe - nicht als ausschließliches Eigentum nur einer unserer beiden Kirchen betrachtet werden kann".(3) Daher nennt die Kommission die beiden Gemeinschaften trotz ihres Gespalten-Seins Schwesterkirchen und erklärt sie für "gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Kirche Gottes ihrer göttlichen Sendung treu bleibt".
Aus katholischer Sicht durfte die Kommission eine solche Erklärung abgeben, weil das 2. Vatikanischen Konzil die katholische Kirche wieder von der Ekklesiologie befreite, die zur Aussage in "Mystici Corporis" geführt hatte. Der erste Entwurf für die dogmatische Konstitution des Konzils über die Kirche, der in der Vorbereitungszeit auf das Konzil ausgearbeitet worden war, entsprach noch der vorangegangenen Denkweise. In ihm war allein die römische Kirche als Kirche Christi anerkannt. Doch dieser Entwurf fand herbe Kritik während der ersten Sitzungsperiode. Daher erarbeitete die Theologische Kommission bis zur zweiten Periode eine neue Vorlage. Auch diese enthielt noch eine Aussage, welche allein die "vom römischen Pontifex und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitete" Kirche als die Kirche Christi bezeichnete. Das Konzilsplenum verweigerte auch dieser Aussage die Zustimmung und nahm eine ausdrückliche Textverbesserung vor.
Wegen der Beschlüsse über die erste und über die zweite Vorlage kann kein Zweifel bestehen, was die wirklichen Intentionen des Konzils waren: Es wollte die Auffassung zurückweisen, dass die unter der Obhut des römischen Bischofs stehende katholische Kirche die alleinige Kirche Christi sei. Schließlich lautete die vom Konzil am 21. November 1964 verabschiedete Konstitution an der betreffenden Stelle: "Diese Kirche (= die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen), in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen"(4). Mit dieser Aussage bestätigten die Konzilsväter einerseits die gläubige Überzeugung der Katholiken, dass sie in ihrer eigenen Kirche die wahre Kirche Christi finden; andererseits stellten sie gleichzeitig klar, dass diese Überzeugung keinesfalls mit der Negation der Würde aller anderen kirchlichen Gemeinschaften verbunden werden darf.
Das Ökumenismusdekret, das in einer und derselben feierlichen Sitzung zusammen mit der dogmatischen Konstitution über die Kirche verabschiedet wurde, erläutert, wie kostbar jene "vielfältigen Elemente der Heiligung und der Wahrheit" sind, die außerhalb der kanonischen Grenzen der katholischen Kirche gefunden werden können. In diesem Dekret heißt es von allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften der christlichen Welt, dass sie in Gottes Heilsplan zu Werkzeugen des Heiles erwählt sind; sie sind "trotz der Mängel, die ihnen nach unserem Glauben anhaften, nicht ohne Bedeutung und Gewicht im Geheimnis des Heiles. Denn der Geist Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen…"(5). Darüber hinaus wird in einem besonderen Abschnitt bezüglich der orientalischen Kirchen auf deren sakramentales Leben verwiesen und es wird hervorgehoben, dass "die orientalischen Christen die liturgischen Feiern begehen, besonders die Eucharistiefeier, die Quelle des Lebens der Kirche und das Unterpfand der kommenden Herrlichkeit, bei der die Gläubigen, mit ihrem Bischof geeint, Zutritt zu Gott dem Vater haben durch den Sohn, das fleischgewordene Wort, der gelitten hat und verherrlicht wurde, in der Ausgießung des Heiligen Geistes, und so die Gemeinschaft mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit erlangen, indem sie der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind"(6). Wegen der Kostbarkeit der heiligen Sakramente wird im Anschluss daran über die orientalischen Kirchen gesagt: "So baut sich auf und wächst durch die Feier der Eucharistie des Herrn in diesen Einzelkirchen die Kirche Gottes …". Im wahren und vollen Sinn werden also die östlichen Kirchen vom 2. Vatikanischen Konzil Kirchen genannt. Unter ausdrücklicher Berufung auf das Konzil führt darum das Dokument "Dominus Jesus" vom 6. August 2000 aus: "Die Kirchen, die zwar nicht in vollkommener Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber durch engste Bande, wie die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie, mit ihr verbunden bleiben, sind echte Teilkirchen. Deshalb ist die Kirche Christi auch in diesen Kirchen gegenwärtig und wirksam, obwohl ihnen die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche fehlt, insofern sie die katholische Lehre vom Primat nicht annehmen, den der Bischof von Rom nach Gottes Willen objektiv innehat und über die ganze Kirche ausübt."(7)
Aus Sicht der orthodoxen Kirche gilt, dass auch in ihr der Patriarchenbeschluss von 1755 nur mehr sehr eingeschränkte Gültigkeit besitzt.
Allerdings verwenden manche katholische Prediger und Katecheten immer noch unkritisch Formulierungen aus Lehrbüchern der Zeit vor dem 2. Vatikanischen Konzil, die den neuen Einsichten widersprechen; und ein Katholik, der in Griechenland, im Patriarchat von Jerusalem oder auf dem Berg Athos orthodox werden will, muss mit größter Wahrscheinlichkeit (anderswo nur falls er in Extremistenzirkel gerät) damit rechnen, dass man ihn nicht als getauften Christen anerkennt, sondern von ihm erwartet, sich beim Übertritt taufen zu lassen.
- Zwei Beispiele seien angeführt, die besonders deutlich zeigen, dass die gegenwärtige kirchliche Praxis die Grenze zwischen Katholiken und Orthodoxen trotz allem noch als Glaubensspaltung behandelt. Von alters her war es selbstverständlich gewesen, dass Kirchengemeinden, die sich wechselseitig als Schwesterkirchen anerkannten, die Glieder der jeweiligen "anderen Seite" uneingeschränkt bei sich zu den heiligen Sakramenten zuließen. Die wechselseitige Zulassung stößt jedoch heute immer noch bei zahlreichen Katholiken und entschiedener noch bei den meisten Orthodoxen auf Widerstand. Als Hauptgrund dafür wird angeführt, dass die Sakramentengemeinschaft erst gewährt werden dürfe, wenn die Glaubensgemeinschaft wiedererlangt sei. Man geht also davon aus, dass es sie derzeit nicht gibt.
Als das 2. Vatikanische Konzil zusammentrat, das bekanntlich die Öffnung der katholischen Kirche für das Gedankengut der ökumenischen Bewegung mit sich brachte, hielten Katholiken und Orthodoxe ihre Bischöfe nicht für Mitbrüder im gleichen Hirtenamt, die miteinander die Verantwortung zu tragen haben für die kirchliche Verkündigung der heiligen Wahrheit. Vielmehr war man überzeugt, dass orthodoxe Bischöfe und Theologen an einem vom Papst einberufenen Konzil nur als Beobachter, nicht als Konzilsväter teilnehmen könnten.
Schismen von unterschiedlichem Gewicht
- Wo in der Bibel dargelegt ist, wie die Kirche sein sollte, heißt es: "Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele" (Apg 4,32). Wie der Kontext deutlich macht, meint der Satz das abstrichlose Miteinander im Lebensvollzug. Eine rein spirituelle Gemeinsamkeit des Glaubens ohne Sozialbezüge wäre ungenügend; die zunächst geistliche Kirchengemeinschaft hat sich auszuwirken auf eine Vielzahl nichttheologischer Belange. Doch beim Blick auf die kirchliche Wirklichkeit lässt sich von dem, was eigentlich gelten sollte, nur in tiefer Zerknirschung reden. Denn von Anfang an und in jeder Phase der Kirchengeschichte gab es Spannungen, Gegensätze, Streit und Spaltungen. Sie alle kann man Schismen nennen, und nicht immer geht es um Glaubensspaltung, wenn betrüblicherweise ein Schisma ausbrach.(8)
Bereits in vorkonstantinischer Zeit, als die Kirche noch illegal war, wurde die Gewichtigkeit der Schismen untersucht(9), und man strebte nach einer Regel, die erlaubte, das Gewicht der Grenzlinien zu ermessen. Schließlich führte dies zur Ausformulierung von Kanon 95 der Trullanischen Synode (des sogenannten Quinisextums(10) von 691/92). Der Kanon nimmt in den Blick, welche Mängel die verschiedenen Sondergruppierungen haben und welcher Grad von Verbundenheit ihnen mit der Kirche verblieb. Dreierlei Weisen verfügt er für die Aufnahme von Konvertiten. Nur in genau benannten Fällen gebietet er, die Konvertiten wie neubekehrte Heiden zu taufen. In anderen Fällen stellt er fest, dass die Konvertiten aus der Sondergruppierung, der sie angehört hatten, bereits kirchliche Gnadengaben mitbringen, und er verlangt, diese anzuerkennen und durch eine Salbung mit Myron zu bezeugen, dass an den Konvertiten ergänzt wird, was ihnen zur vollen Kirchenzugehörigkeit fehlte. In wieder anderen Fällen räumt der Kanon ein, dass die Konvertiten auch als Schismatiker bereits im vollen Sinn Glieder der Kirche waren, so dass diese nur ihre bisherigen Verirrungen zu widerrufen brauchten. Es wurde also anerkannt, dass sich bei manchen Schismen jenseits der Grenzlinie wichtige Elemente von Kirchlichkeit finden, und dass dort manchmal auch im Vollsinn des Wortes die Kirche selbst vorhanden war.
- Gehen wir nun, von diesen Überlegungen angeleitet, zurück in die Kirchengeschichte und sehen wir zu, wie die Lateiner und die Griechen jeweils ihr wechselseitiges Verhältnis beurteilten, als sie sich längst schon als zueinander "im Schisma lebend" verstanden.
Noch 1651 war es möglich, dass ein zu Rom "im Schisma stehender" Bischof einem mit Rom unierten Bischofskandidaten die Bischofsweihe erteilte. Der damalige Weihespender war Bischof Simion ªtefan von Alba Julia, der Weiheempfänger war der gewählte Bischof von Mukaèevo Petr Petroviè Parfenij. Diesen hatte Georg Lippay, der damalige (selbstverständlich lateinische!) Primas von Ungarn, betraut mit der Seelsorge für die Gläubigen von byzantinischer Tradition in Oberungarn, die 1646 eine Union mit der lateinischen Kirche geschlossen hatten. Die Urkunde des lateinischen Würdenträgers über die Beauftragung Parfenijs war für Bischof Simion ªtefan Grund genug, die Weihe zu erteilen. Als Primas Lippay sich in Rom für den neu geweihten Bischof verwandte, damit dieser von allen eventuellen kirchlichen Zensuren wegen der Weihe durch einen "Schismatiker" freigesprochen werde, bezeugte er ausdrücklich, dass der weihende Bischof um das Uniert-Sein des Weihekandidaten wusste. Dass Lippays Intervention in Rom erfolgreich war, zeigt, dass man auch dort das Geschehene nicht ablehnte.(11)
Das Ereignis passte sehr wohl in die Zeit. Aufschlussreiches erfahren wir z.B. in einem Bericht, den der französische Jesuit F. Richard 1657 über einen griechischen Bischof publizierte,(12) der im Oktober 1650 im Auftrag des Konstantinopeler Patriarchen als Visitator nach Santorina kam. Der Visitator habe einem Jesuiten beim Predigen zugehört, schreibt F. Richard, und sei über das Wirken der Patres so froh gewesen, dass er ihnen auf ihre Bitte um Predigterlaubnis für die griechischen Kirchen des Archipels eine Urkunde ausstellte, in der er "alle Priester und Amtsinhaber unter der Jurisdiktion seines Patriarchen aufforderte, uns [d.h. die Jesuiten] in allen ihren Kirchen wie ihn selbst aufzunehmen und unseren Vätern ohne Widerspruch überall, wo es die Väter wünschen, das Predigen des Wortes Gottes zu erlauben".
Auch dies war keine Ausnahme, denn viele "schismatische" Würdenträger verließen sich damals auf Missionare aus Rom. Der Lebenslauf des Panteleimon (Paisios) Ligarides mag dafür als Beispiel dienen. 1609/10 auf Chios von Eltern geboren, die als uniert galten, war er ans griechische Kolleg nach Rom gekommen und nach seinen Studien auch Lehrer am Kolleg gewesen. 1639 wurde er dort zum Priester geweiht und von der Congregatio de Propaganda Fide 1641 in den Osten entsandt. Ohne dass er die Bindung an Rom hätte aufgeben und auf die Besoldung aus Rom hätte verzichten müssen, erlangte er eine Vertrauensstellung beim Konstantinopeler Patriarchen Parthenios I. und die Erlaubnis, in dessen Kathedrale zu predigen, zu zelebrieren und Beichte zu hören. Später wurde er Hofprediger beim "schismatischen" Fürsten der Walachei. Er begründete und leitete die erste neuzeitliche Schule des walachischen Fürstentums. Besoldet wurde er weiter aus Rom, denn er galt unverändert als Missionar der Congregatio de Propaganda Fide. Am walachischen Fürstenhof wurde er mit dem "schismatischen" Patriarchen Paisios von Jerusalem bekannt, reiste mit ihm 1651 nach Jerusalem und wurde von ihm im folgenden Jahr zum Bischof geweiht. Auf dem Rückweg in die Walachei besuchte er den für die dortigen Lateiner zuständigen Bischof und legte ihm dar, das Glaubensbekenntnis bei seiner Bischofsweihe sei ausdrücklich so formuliert worden, dass seine Bindung an Rom habe erhalten bleiben können. Bald darauf nahm er eine Einladung nach Moskau an und wurde Berater des Patriarchen und des Zaren.(13)
- Die Zahl solcher Beispiele könnte nahezu beliebig vermehrt werden.(14) Doch wir wollen statt dessen zur Konziliengeschichte übergehen und eine Parallele aufzeigen zwischen den sieben ökumenischen Konzilien der Spätantike und jenen Konzilien des 15. bis 16. Jahrhunderts in Konstanz, Basel, Ferrara/Florenz und Trient, die nur den Lateinern, nicht aber den Griechen als ökumenisch gelten.
Yves Congar stellte in der Schrift "Zerrissene Christenheit" heraus, dass Rom und Konstantinopel zur Zeit der altkirchlichen ökumenischen Konzilien insgesamt mehr als 200 Jahre zueinander im Schisma standen. Er zitiert zwei kirchengeschichtliche Untersuchungen. In einer von ihnen wird aufgezeigt, dass es in den 464 Jahren vom Beginn der Alleinherrschaft Konstantins (im Jahre 323) bis zum 7. ökumenischen Konzil (im Jahre 787) zwischen den Griechen und den Lateinern fünf Schismen mit zusammen 203 Jahren gab. Die andere Untersuchung berichtet von sieben Schismen mit zusammen 217 Jahren, die es in den 506 Jahren vom Tod Kaiser Konstantins (im Jahre 337) bis zur endgültigen Annahme der Beschlüsse des 7. ökumenischen Konzils durch die Kaiserstadt Konstantinopel (im Jahre 843) gab. Mit anderen Worten: In jenen Jahrhunderten, in denen Griechen und Lateiner sechs von ihren sieben gemeinsamen ökumenischen Konzilien feierten, bestand zwischen ihnen nahezu die halbe Zeit über keine volle Communio.(15)
Den Griechen und den Lateinern jener Zeit war es nicht in den Sinn gekommen, den anderen wegen des Schismas das Kirche-Sein abzustreiten. Daher konnten sich ihre Bischöfe auf gemeinsamen Konzilien begegnen als Mitbrüder im gleichen Hirtenamt, die trotz der Schismen, die zwischen ihnen wiederholt ausgebrochen waren, miteinander die Verantwortung zu tragen hatten für die kirchliche Verkündigung der heiligen Wahrheit. Sie hielten ihre Gemeinschaften nämlich für Schwesterkirchen, die eigentlich zusammengehören und auch im Zustand des Schismas hinreichend aufeinander bezogen blieben, so dass die Aussöhnung leicht erreichbar war.
Nicht anders war es, als sich die Lateiner während des 1378 ausgebrochenen großen Papstschismas in Konstanz und Basel zu Konzilien versammelten und einzelne griechische Konzilsteilnehmer anreisten, um mit ihren abendländischen Mitbrüdern bei der Suche nach dem Wiedererlangen der Einheit der lateinischen Kirche solidarisch zu sein und sich zugleich um die Beendigung der Spaltung zwischen Lateinern und Griechen einzusetzen.
Noch deutlicher war die Ähnlichkeit zu den altkirchlichen Konzilien, als die Bischöfe beider Seiten 1438 gleichberechtigt zum Konzil von Ferrara/Florenz zusammentraten, das ganz und gar der Suche nach Einheit zwischen Lateinern und Griechen gewidmet war,(16) auch wenn das Ziel der Aussöhnung dann schließlich doch nicht wirklich erreicht werden konnte. Sogar noch für das Konzil von Trient (1545-48, 1551-52 und 1562-63) wünschten die Päpste - vergeblich - die volle Teilnahme "schismatischer" Bischöfe aus dem Osten.(17) Noch im 16. Jahrhundert hätten die Päpste als wünschenswerte Ergänzung angesehen, was die Katholiken und die Orthodoxen beim 2. Vatikanischen Konzil für ausgeschlossen hielten.
Wann und wieso fing man an, das Schisma zwischen Katholiken
und Orthodoxen für eine Glaubensspaltung zu halten?
Irgendwann zwischen dem Konzil von Trient und dem 2. Vatikanischen Konzil muss es begonnen haben, dass Katholiken und Orthodoxe das Schisma zwischen sich für viel schwerwiegender beurteilen, als ihre Väter es getan hatten; dass sie das Schisma für eine Scheidelinie halten, welche die bis ins 17. Jahrhundert möglich gewesene Sakramentengemeinschaft und die gemeinsame Verantwortung der Bischöfe für die Glaubenslehre der Kirche verbietet; dass sie meinen, das Schisma bedeute eine wirkliche Glaubensspaltung. Wann und wie ist dies geschehen?
- Als man im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts in Polen die Brester Union vorbereitete,(18) hatten dort bestimmte Jesuiten, darunter ihr führender Theologe Petrus Skarga, begonnen, je länger desto deutlicher zu lehren, dass es für die Christen nach Gottes heiligem Willen unabdingbar sei und für sie sogar ein Heilserfordernis darstelle, unter der Obhut des obersten Hirten in Rom, des Nachfolgers Petri, zu stehen. Die wirkliche Befähigung der nicht auf Rom bezogenen östlichen Kirchen zum Dienst für das Heil der Seelen wurde von ihnen in Frage gestellt. Wer durch ihre Neuerung beeinflusst war, musste der Meinung sein, dass die Kirchen griechischer Tradition wegen ihres Getrennt-Seins vom Papst schwer in die Irre gegangen seien. Allen Theologen, die wie Petrus Skarga dachten, mussten diese Kirchen zutiefst verletzt erscheinen. Ihre Bischöfe konnten sie nicht mehr als Mitbrüder der lateinischen Bischöfe im Hirtenamt betrachten, und in tiefe Sorge um jene Schafe Christi mussten sie geraten, die ihres Erachtens schwer in die Irre geleitet worden waren.
Ausmaß und Tempo der Ausbreitung dieser Ekklesiologie, die im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts in Polen einsetzte, bedürfen noch der Klärung. Zunächst wurde die neue Sichtweise von einer Minderheit unter den Lateinern vertreten, und es sollte noch fast zwei Jahrhunderte dauern, bis sie überall in der lateinischen Kirche vorherrschend wurde und dann auch in den Kirchen byzantinischer Tradition eine sozusagen "spiegelbildliche" Anwendung fand.
Nach einem längeren Ringen, bei dem in der lateinischen Christenheit zeitweise die traditionelle Sicht vom Schisma zwischen Lateinern und Griechen den Vorzug zu haben schien (und daher um die Mitte des 17. Jahrhunderts noch die oben geschilderten Fälle von Sakramentengemeinschaft möglich waren), zeitweise hingegen die nachtridentinische Neuerung bevorzugt wurde, setzte sich im 18. Jahrhundert die neue Ekklesiologie bei den Lateinern und bald danach ihr "Spiegelbild" bei den Griechen fast vollständig durch.(19)
Die Lateiner, denen fortan das pastorale Geführtwerden durch den Nachfolger Petri als Heilsbedingung galt, bestritten nunmehr, dass die griechischen Kirchen, denen die Bezogenheit auf den Papst abgeht, zur Verwaltung der heiligen Sakramente berechtigt seien. Von den Griechen erteilte Sakramente, lehrten sie, seien zwar gültig, aber illegitim. Ein Dekret der Congregatio de Propaganda Fide verbot 1729 kategorisch jegliche "communicatio in sacris" (d.h. jegliche Gemeinsamkeit des Betens, die Gemeinsamkeit in irgendwelchen geistlichen Dingen und ganz besonders die Gemeinsamkeit bei den heiligen Sakramenten) zwischen Christen, die dem Papst verbunden waren, und solchen, die dies nicht waren. Umgekehrt erklärten die griechischen Patriarchen durch den schon oben zitierten Beschluss aus dem Jahr 1755 die westlichen Christen für ungetauft.
Seither hielten und halten zahlreiche Theologen die Lateiner und die Griechen für "im Glauben getrennt". Damit war eine Position quasi allgemeinverbindlich geworden, die von bestimmten Theologen und Kirchenführern in ihrer privaten Meinung schon jahrhundertelang für richtig gehalten worden war.
- Im 19. Jahrhundert, als die Existenz einer Glaubensspaltung bereits von fast allen für eine Tatsache gehalten wurde, begannen die Kirchengeschichtler zu untersuchen, wann sie erfolgt sei. Weil sie von dem Vorurteil besessen waren, dass "ganz gewiss" eine uralte Tradition besitzen müsse, was zu ihrer Zeit für "unbestritten" galt, ignorierten sie die geistliche Gemeinsamkeit, welche Lateiner und Griechen bis ins 17. Jahrhundert noch übten, und sie dachten auch nicht an die Vorgänge im 18. Jahrhundert. Vielmehr hielten sie Ausschau nach Ereignissen in ferner Vergangenheit.
Da jedoch damals die Editionen von Akten der ökumenischen Konzilien noch in den Kinderschuhen steckten, konnten sie über die früheren Kirchenversammlungen noch nicht zutreffend urteilen. Doch über das Konzil von Konstantinopel von 869/70, das von den Lateinern seit Roberto Bellarmino (1542-1621) als ökumenisch angesehen wurde,(20) wussten sie, dass es den Patriarchen Photios verurteilt hatte. Dass der Papst dieses Konzil bald darauf für ungültig erklärte, dass 879/80 nochmals ein "photianisches" Konzil in vollem Frieden zwischen Rom und Konstantinopel tagte, und dass Photios in seiner zweiten Amtsperiode (877-886) und bis zu seinem Tod in Communio mit dem Papst lebte, wusste man allerdings nicht.(21) In Unkenntnis des tatsächlichen Geschichtsablaufes meinte man daher, Photios die Schuld an der Spaltung zuschreiben zu können. Denn in seiner Enzyklika an die östlichen Patriarchen, die hinreichend bekannt war, sind zahlreiche Vorwürfe gegen die Lateiner und auch ein Protest gegen das "filioque" enthalten. Dies sei der Gegensatz im Glauben, meinte man, auf den die Kirchenspaltung zurückgehe, und man nannte die Orthodoxen nach dem Vorbild der evangelischen Christen, die zu Recht "Lutheraner" oder "Kalviner" heißen, kurzerhand "Photianer".(22)
Zwei schwere Fehler hat man dabei begangen. Erstens hat man die Texte, die Photios geschrieben hatte, nicht am kirchlichen Leben aus dessen Zeit gemessen. Hätte man dies getan, wäre offenkundig geworden, dass Photios nur während des Streites den Lateinern vorhielt, ihre Theologie und ihre Bräuche seien mangelhaft und abzuweisen. Als Friede eingetreten war zwischen den beiden Kirchen, ließ Photios die Theologie und die Bräuche der Lateiner wieder ebenso gelten, wie dies seine Kirche vorher getan hatte. Hätte Photios das, was er während des Streites als "Mängel der Lateiner" bezeichnet hatte, für echte dogmatische Irrtümer gehalten, dann hätte er vor dem Friedensschluss die Verbesserung einfordern müssen. Aber genau dies tat er nicht. Sein Vorwurf war also nicht, dass die Lateiner im Glauben irrten, sondern dass ihre theologische Ausdrucksweise und ihr kirchliches Leben Schwächen hätten. Dies begründet aber keine Glaubensspaltung, denn Schwächen hat bekanntlich auf Erden das Leben jeder Kirche. Der zweite Fehler jener, die den Namen "Photianer" prägten, war, dass sie überhaupt nur die Synode von 869/70 beachteten. Sie übersahen, dass Photios während seiner 2. Amtszeit mit Rom in voller Gemeinschaft stand. Im Grunde genommen steht der Name Photios nicht für Trennung, sondern für ein erfolgreiches Suchen nach Einigung.
Als die kirchengeschichtliche Forschung dies entdeckte und zur Kenntnis nehmen musste, dass Photios in seiner 2. Amtszeit und bis zu seinem Tod mit Rom in Communio stand, war die Datierung des Schismas in seine Tage nicht mehr möglich. Also suchte man nach anderen "Schuldigen" und schuf den Mythos von einer angeblichen Kirchenspaltung im Jahr 1054. Man wies also fortan dem Patriarchen Michael Kerullarios und dem Kardinal Humbert de Silva Candida - ohne Beachtung der vielen Schismen vor ihrer Zeit und der zahlreichen Fakten von Gemeinsamkeiten nach ihnen und ohne eine genaue Lektüre der Urkunden aus ihren Tagen - die Schuld an der Glaubensspaltung zu.
Es gilt festzuhalten: Kardinal Humbert war mit dem Auftrag nach Konstantinopel gereist, sich dort um einen Ausgleich zu bemühen. Auch als sich ergeben hatte, dass ein solcher aus vielerlei nichttheologischen Gründen nicht zu erreichen war, gab es im Jahr 1054 keine Exkommunikation der lateinischen gegen die griechische Kirche und keine solche der griechischen gegen die lateinische. Nur auf einzelne Persönlichkeiten bezogen sich die damaligen Exkommunikationsbullen. Nur den Patriarchen und einige seiner Mitarbeiter exkommunizierten die römischen Legaten "ad personas", und einige Tage später exkommunizierte der Patriarch, ebenfalls "ad personas", nur die Legaten.(23)
Versöhnungsversuche, die misslingen, verursachen in der Regel eine Eskalation der Gegensätze. Dies gilt zweifellos auch von den Ereignissen des Jahres 1054, zumal hochgestellte Persönlichkeiten beteiligt und von den Anathemata betroffen waren. Was damals geschah, steigerte die Disharmonie, doch ansonsten blieb alles beim Alten. Wie früher war man einander auch weiterhin wenig gewogen, man verdächtigte einander, half einander gelegentlich in bestimmter Hinsicht, stritt dann wieder untereinander, verhandelte zeitweise erneut, betrachtete einander die meiste Zeit als gegenseitig exkommuniziert und strebte dann doch wieder nach einer zumindest eingeschränkten Sakramentengemeinschaft. So war es vor dem Jahr 1054 jahrhundertelang gewesen; so blieb es weiterhin.
Schon damals galten die Vorkommnisse als schwer zu ertragen. Aber erst, als man im späten 19. Jahrhundert Photios nicht mehr zum Sündenbock für die Spaltung hat nehmen können, fing man an, in den Ereignissen von 1054 den Anfang eines sogenannten "großen Schismas" sehen zu wollen. Wegen der stark übertriebenen Bedeutung, die deswegen den Bullen von 1054 landläufig zugemessen wurde, war es gut, dass Papst und Patriarch von Konstantinopel während des 2. Vatikanischen Konzils gemeinsam erklärten, sie möchten diese aus dem Gedächtnis der Kirchen streichen.(24) Doch weil mit den Bullen das Schisma nicht begonnen hatte, konnten sie mit ihrer Erklärung am Schisma zwischen Orthodoxen und Katholiken auch nichts ändern. Sie wollten beenden, was das Denken der Menschen vergiftet. Wir sollten ihrem Vorschlag folgen und diese Urkunden Vergangenheit sein lassen. Keiner sollte mehr nachplappern, was zu einer Zeit in die Welt gesetzt wurde, zu der die Kirchenhistoriker einen Großteil der inzwischen bekannt gewordenen Geschichtsquellen noch nicht kannten.
- Von manchen Kreisen, die bereits einsahen, dass das sogenannte "große Schisma von 1054" ein Phantasieprodukt ist, wurde inzwischen versucht, in den Ereignissen bei der Eroberung Konstantinopels durch Kreuzfahrer aus dem Abendland im Jahr 1204 die Hauptursache für die Kirchentrennung zwischen Ost und West zu vermuten.
Es steht außer Zweifel, dass das, was 1204 geschah, der Christenheit in höchstem Maß unwürdig ist und zu jenen Ereignissen in unserer Geschichte gehört, deren die Christen sich tief zu schämen und gemäß den Worten des "Vater unser" einander um Vergebung zu bitten haben. Damals geschahen Grausamkeiten, denen Intrigen und Gehässigkeiten vorangegangen waren und auf die wieder solche folgten. Doch trotz ihrer tiefen Verwerflichkeit sind diese Ereignisse allesamt nichttheologische Faktoren des Zerwürfnisses. Als nichttheologische Angelegenheiten können sie keine Glaubensspaltung verursacht haben, und wir dürfen sie ausklammern bei unserer Suche nach dem Zeitpunkt, zu dem man anfing, das Schisma zwischen Lateinern und Griechen als Glaubensspaltung zu bewerten. Nur die wechselseitigen Animositäten konnten diese Ereignisse anheizen, und das haben sie zweifellos in höchsten Ausmaß getan. Sie haben viel Schuld daran, dass Lateiner und Griechen in bürgerlicher Hinsicht zu einem glatten Gegenteil von "einem Herzen und einer Seele" wurden, was sie als Christen eigentlich zu sein hätten.
- Völker, die derselben Kirche angehören, haben im Lauf der Weltgeschichte viele und zum Teil sehr grausame Kriege miteinander geführt; doch nie spricht man von Kirchenspaltungen in deren Gefolge. So hat zum Beispiel auch noch keiner versucht, den "Sacco di Roma" von 1527, der der Eroberung Konstantinopels an Brutalität kaum nachstand, zur Ursache dafür zu erklären, dass die kurz vorher ausgebrochene Reformation zur Kirchenspaltung zwischen Rom und einem Großteil der Deutschen führte.(25)
Wann wurden für Lateiner und Griechen
die Bezeichnungen Katholiken bzw. Orthodoxe üblich?
Als Adjektive, die wichtige Eigenschaften einer jeden Kirche aussprechen, sind die beiden Bezeichnungen uralt. Aus diesen Eigenschaftswörtern hat man nach dem Umbruch in der Ekklesiologie, der im 18. Jahrhundert vor sich gegangen war, neue Eigennamen für die lateinische und für die griechische Kirche gebildet. Durch die neuen Namen bringen die Anhänger der neuen ekklesiologischen Denkweise zum Ausdruck, dass sie endlich einer von intransigenten Kontroverstheologen schon lange vorgetragenen Meinung zum Sieg verhelfen konnten und jetzt sozusagen amtlich vertreten dürfen, dass die beiden Kirchen gegensätzliche Konfessionen seien.
- Das aus dem Griechischen entlehnte Eigenschaftswort "orthodox" bedeutet "rechtgläubig". Verständlicherweise nimmt jede Kirche für sich in Anspruch, rechtgläubig zu sein; einer Kirche, die von sich das Gegenteil behauptete, müsste geraten werden, sich schnellstens zu bekehren. Alle Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften haben Grund, sich im Sinn der Wortbedeutung orthodox zu nennen.
Petr Mogila, ein führender Theologe der heutzutage in konfessioneller Hinsicht "orthodox" genannten Kirche,(26) kannte für seine Kirche noch nicht den Eigennamen "orthodox". Er war im Jahr der Brester Union geboren worden, erreichte 1632, anlässlich der Wahl des Nachfolgers für König Sigismund II., unter dem die Brester Union geschlossen wurde, für jene Christen Polens, die sich der Union verweigert hatten, die vollen öffentlichen Rechte und wurde ihr erster öffentlich-rechtlich anerkannter Metropolit. Er verwandte für seine eigene Kirche die Bezeichnung "nicht-uniert" und nannte sowohl die Unierten als auch die Nichtunierten "rechtgläubig".(27)
In Siebenbürgen stoßen wir in der Antwort, die Gherontie Cotore auf die Predigten des Mönches Visarion Sarai erteilte(28), für die Unierten auf die Bezeichnung "orthodox"(29)(dreptcredincioºi); die Gegenseite nennt er wie Petr Mogila "nichtuniert". Wie Cotore verwenden auch die amtlichen Siebenbürgener Urkunden der nachfolgenden Jahrzehnte für Christen, die sich der Union verweigerten, den Terminus "nichtuniert", nicht aber den Ausdruck "orthodox". Bei diesem Terminus blieb es im Habsburgerreich, bis man später wegen Unzufriedenheit mit einem Namen, der nicht zum Ausdruck brachte, was man war, sondern aussagte, was man nicht war, den Terminus "griechisch-orientalisch"(30) und schließlich "griechisch-orthodox" prägte.
- Auch das Eigenschaftswort "katholisch" ist aus dem Griechischen entlehnt und bedeutete zunächst "für alle vorhanden". Weil sie "für alle vorhanden" zu sein hat, wird die Kirche im nizäno-konstantinopolitanischen Symbolum die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche genannt. Alle Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die sich auf dieses Symbolum beziehen, sind berechtigt, sich "katholisch" zu nennen.
Dass das Wort zum Eigennamen einer einzigen Kirche wurde, geschah in den Wirren, die aus dem Auftreten der Reformatoren erwuchsen. Bei den nachfolgenden innerabendländischen Auseinandersetzungen begann man, jene Ortskirchen "katholisch" zu nennen, die sich von den Reformatoren nicht abbringen ließen von ihrer Treue zur kirchlichen Tradition. Als mit der Zeit für die Griechen die Bezeichnung "Orthodoxe" üblich gewordem war, hielt man es auch in Osteuropa für passend, die Lateiner in Zukunft "Katholiken" zu nennen.
- Zusammen mit Historikern, die den Mythos von einer zwischen Lateinern und Griechen vor urvordenklichen Zeiten eingetretenen Glaubensspaltung in die Welt setzten, hat man sich im 19. und 20. Jahrhundert angewöhnt, die Konfessionsbezeichnungen "katholisch" und "orthodox" in die Jahrhunderte vor dem 18. Jahrhundert zurückzuprojizieren, obwohl die Geschichtsquellen aus jener Zeit dafür keine Handhabe bieten. Eine Vielzahl von historischen Fehlurteilen in zahlreichen Geschichtsbüchern ist davon die Folge. Denn Autoren, welche es unterließen, jeweils genau nach den Gründen für die je zeitgenössischen Gegensätze zwischen Lateinern und Griechen zu forschen, ließen sich zu der Fehleinschätzung verführen, bereits die mittelalterlichen Spannungen zwischen ihnen seien ebenso eine Glaubensspaltung in "Katholiken" und "Orthodoxe" gewesen wie das, was wegen der ekklesiologischen Neuerung des 18. Jahrhunderts eine traurige neuzeitliche Realität geworden ist.
-------
Die Enzyklika wurde veröffentlicht in: AAS 25(1943)193-248; deutsche Übersetzung in: H. Schäufele, Unsere Kirche, Heidelberg 1946 (Unterstreichung von uns!) Mansi XXXVIII, 575-644: Synodi Constantinopolitani de iterando baptismo a Latinis collato 1755 a mense ianuario ad iulium; Zitat von Spalte 619. Zum theologiegeschichtlichen Hintergrund der gesamten Frage vgl. Suttner, Die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Zur Anerkennung der Taufe westlicher Christen durch die orthodoxe Kirche im Laufe der Geschichte, in: N. Rappert (Hg.), Kirche in einer zueinander rückenden Welt, Würzburg 2003, S. 249-295. Das französische Original der Erklärung ist veröffentlicht in: Irénikon 66(1993)347-356. Lumen gentium, Art. 8 Unitatis redintegratio, Art. 3. Unitatis redintegratio, Art. 15. Das Dokument wurde veröffentlicht in: AAS 92(2000)742-765. Ex professo wird diese Tatsache behandelt in der Broschüre: Suttner, Schismen, die von der Kirche trennen, und Schismen, die von ihr nicht trennen (Ökumenische Wegzeichen, Publiés par l’Institut d’études oecuméniques de l’Université de Fribourg, 15), Fribourg 2003. Vgl. Suttner, Der Wandel im Verständnis von Schisma und Kirchenunion im Lauf der Jahrhunderte, in: N. Rappert (Hg.), Kirche in einer zueinander rückenden Welt, S. 137-154. Bei dieser Synode handelt es sich um eine fast nur von Griechen besuchte Synode, welche das 5. und das 6. Ökumenische Konzil um kirchenrechtliche Bestimmungen "ergänzen" sollte und daher seinen aus den Worten "fünf" und "sechs" zusammengesetzten Namen erhielt. Zu Einzelheiten bezüglich der Union des Bistums Mukaèevo und für Quellenangaben zu den Vorgängen rund um die Bischofsweihe an Petr Petroviè vgl. M. Lacko, Die U¾horoder Union, in: OS 8(1959)3-30 und W. de Vries, Rom und die Patriarchate des Ostens, S. 114-131; sowie Suttner, Die rumänische Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts in Auseinandersetzung mit der Reformation, in: Kirche im Osten 25(1982)64-120 (besonders S. 84-86). F. Richard, Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable à Saint-Erini … depuis l’établissement de Pères de la Compagnie des Jesus, Paris 1657, S. 59f. Für Belegstellen vgl. Suttner, Panteleimon (Paisios) Ligarides und Nicolae Milescu. Ein Beitrag zur Frage nach der Offenheit des walachischen Fürstentums für das Bildungsgut der Zeit im zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts, in: Kirche im Osten 26(1983)73-94. Zahlreiche weitere Beispiele und Angaben bezüglich der Quellen, aus denen sie erhoben wurden (aber auch dort nur eine Auswahl, weil eine volle Liste der uns zugänglichen Informationen jeden Aufsatz sprengen müsste!) bei Suttner, Die Christenheit aus Ost und West auf der Suche nach dem sichtbaren Ausdruck für ihre Einheit, Würzburg 1999, S. 145-156. Yves Congar, Zerrissene Christenheit, Wien 1959, S. 111. Mit diesem Konzil befasste sich in ganz besonderer Weise Joseph Gill; vgl. von seinen Arbeiten vor allem die Monographie: The Coucil of Florence, Cambridge 1961. Auch beim Tridentinum gab es Teilnehmer aus dem Osten, aber sie waren entweder Lateiner aus den venezianischen Kolonien oder Griechen von dort, die einen Lateiner zum Metropoliten hatten und gemäß den Beschlüssen des 4. Laterankonzils als uniert mit der lateinischen Kirche galten. Theobald Freudenberger hebt jedoch hervor, dass Pius IV., der Papst der dritten Sitzungsperiode, "weder Mühe noch hohe Kosten (gescheut habe), um auch Vertreter der schismatischen Kirchen des Ostens nach Trient zu bringen". Doch infolge der damaligen politischen Lage blieben seine Einladungen erfolglos. (Vgl. Th. Freudenberger, Das Konzil von Trient und das Ehescheidungsrecht der Ostkirche, in: Wegzeichen, Würzburg 1971, S. 165. G. Hofmann, L’Oriente nel Concilio di Trento, in: Studia Missionalia 2[1946]33-54, verweist außerdem auf die Einladungsbullen Pauls III. und Julius III., in denen die "schismatischen" Orientalen "implizit" geladen wurden, und auf eine Reihe dringlicher Einladungen von Pius IV. an griechische und altorientalische Patriarchen und an weltliche Repräsentanten der Äthiopier, der Russen und der Moldauer Rumänen.) Vgl. Suttner, Die Anfänge der Brester Union, in: N. Rappert (Hg.), Kirche in einer zueinander rückenden Welt, S. 339-370. Für das Ringen und schließlich das Durchsetzen der Neuerung vgl. die Abschnitte "Nachtridentinische Auffassungen setzen sich durch" und "Wandel im Verständnis vom Schisma" bei Suttner, Die Christenheit aus Ost und West auf der Suche nach dem sichtbaren Ausdruck für ihre Einheit, S. 186-202 und 279-292; sowie ders., Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, ²Fribourg 2002, S. 73-84; ders., Wandel im Verständnis von Schisma und Union. Von Bischof Cyprian von Karthago bis ins 20.Jh., in: OCP 69(2003)267-285 Zu Bellarmins Zählung der ökumenischen Konzilien vgl. V. Peri, Il numero dei concili ecumenici nella tradizione cattolica moderna, in: Aevum 37(1963)430-501. Über ihn hat Joseph Hergenröther bahnbrechende Forschungen durchgeführt; vgl. ders, Photios, Patriarch von Constantinopel, 3 Bde, 1867-69. Dies kam auch in offiziellen Texten vor, z.B. in einem Hirtenbrief des Pariser Erzbischofs Sibour zur Zeit des Krimkriegs, den der Erzbischof für einen "Kreuzzug gegen die Photianer" hielt (vgl. die Ausführungen zu Chomjakovs Entgegnung auf das Hirtenschreiben bei Suttner, Offenbarung, Gnade und Kirche bei A.S.Chomjakov, Würzburg 1967, S. 137 ff) oder noch 1933 im Vorwort einer von der römischen Kurie veröffentlichten Liste der katholischen Titularbistümer (S. Congregatio Consistorialis, Index sedium titularium Achiepiscopalium et Episcopalium, Vatikan 1933). Zu diesen Vorgängen vgl. den Abschnitt "Der Unionsversuch von 1054" bei Suttner, Die Christenheit aus Ost und West auf der Suche nach dem sichtbaren Ausdruck für ihre Einheit, S. 69-73. Es ist unsinnig, wenn des öfteren gesagt wird, Papst und Patriarch hätten die Exkommunikationen von 1054 "aufgehoben". Nach den Grundsätzen des Kirchenrechts ist nach dem Tod der Gebannten kein "Aufheben" einer Exkommunikation mehr möglich, denn nach dem Tod unterliegen alle nur mehr der Gerichtsbarkeit des Weltenrichters. In ihrer gemeinsamen Erklärung heißt es bezüglich der Vorkommnisse von 1054, es sei "wichtig, die Übertreibungen wahrzunehmen, von denen sie befleckt wurden und die später zu Folgen geführt haben, die … über die Absichten und Annahmen ihrer Urheber hinausgingen, deren Zensuren sich auf die angezielten Personen und nicht auf die Kirchen erstreckten …" Der Papst und der Patriarch mit seiner Synode erklärten deshalb "in gemeinsamem Einvernehmen, … dass sie die Exkommunikationssentenzen … deren Erinnerung einer Annäherung in der Liebe bis heute hindernd im Wege steht, bedauern, aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche tilgen und dem Vergessen anheimfallen lassen …" (Eine deutsche Übersetzung der gemeinsamen Erklärung in: Pro Oriente, Tomos Agapis, Innsbruck-Wien-München 1978, S.86-88). In LThK, ³VIII,1412 schreibt Josef Gelmi im Gegenteil sogar, der Sacco di Roma "bahnte in Rom den Weg für Umkehr und Erneuerung". Vgl. Suttner, Petr Mogila als Wegbereiter der Moderne, in: N. Rappert (Hg.), Kirche in einer zueinander rückenden Welt, S. 406-413. Vgl. Suttner, Metropolit Petr Mogila und die 1644 verfasste "Sententia cuiusdam nobilis Poloni graecae religionis" über die Einigung der Kirchen, in: N. Rappert (Hg.), Kirche in einer zueinander rückenden Welt, S. 394-405. Gherontie Cotore, Despre Articuluºurile ceale de price, hrsg. von Laura Stanciu, Alba Iulia 2000. Vgl. die Dokumente, die publiziert sind bei M. Sãsãujan, Politica bisericeascã a Curþii din Viena în Transilvania (1740-1661), Cluj 2002; ders., Habsburgii ºi Biserica Ortodoxã din Imperiul austriac 1740-1761, Cluj 2004. Diese Bezeichnung kam zustande, weil man in Österreich bei "orthodox" noch immer die Grundbedeutung des Eigenschaftswortes mithörte und nur bei den Katholiken von "Rechtgläubigkeit" reden wollte. Hierzu vgl. unter anderem auch Suttner, Österreichs Politik gegenüber der griechisch-katholischen Kirche Galiziens, in: ders., Kirche und Nationen, Würzburg 1997, S. 333-346.
|